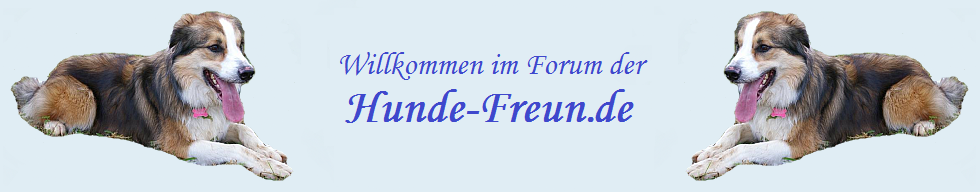Schmitt, Günter (1999)„Unter Lernen verstehen wir den Erwerb, die Veränderung oder den Abbau von Erlebens- und Verhaltensweisen durch bestimmte Umwelterfahrungen.“
Lernen bedeutet also, aus gemachten Erfahrungen Konsequenzen zu ziehen.
Hunde lernen ihr Leben lang und immer. In jeder Situation – dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man einen Vierbeiner zu seiner Familie zählt; erleichtert es das Zusammenleben und Verständnis für den Hund doch ungemein.
Durch den Lernprozess verarbeitet der Hund Umweltreize, passt sein Verhalten entsprechend an und kann so auf neue Umweltbedingungen/Reize reagieren.
Damit dem Hund das Lernen leicht fällt, gilt es ein paar Dinge zu beachten:
- ein kranker, müder oder erschöpfter Hund, ist in seiner Aufnahmebereitschaft eingeschränkt
- auch Angst und „Unlust“ mindert den Lernerfolg – ein motivierter Hund, mit positiven Gefühlen lernt besser!
- (starker) Stress behindert den Lernprozess ungemein und macht ihn fast unmöglich
- Trainingsschritte/Herausforderungen für den Hund sollten möglichst so gestellt sein, dass sie von dem Hund in jedem Fall gelöst und verarbeitet werden können
- der Hund sollte sich natürlich konzentrieren können und nicht von den Umgebungsreizen abgelenkt werden – dementsprechend wählt man die Umgebung, wo trainiert wird.
Deshalb trainiert man in kleinen Schritten mit einem möglichst gesunden, entspannten Hund und wählt Umgebung und Anforderungen so aus, dass es dem Hund keine Probleme bereitet, die gestellten Aufgaben zu bewältigen!
Konditionierung
Wenn man sich ein wenig mit Verhaltenstraining beschäftigt, trifft man quasi überall auf den Begriff „Konditionierung“. Konditionierung ist das bilden von Reiz-Reaktions-Ketten und im Alltag mit dem Hund ein ständiger Begleiter. Man unterscheidet dabei „klassische Konditionierung“ und „operante Konditionierung“. Im Hundetraining greifen operante und klassische Konditionierung übrigens häufig ineinander - trennen lässt sich das nicht immer.
Bekannt wurde die klassische Konditionierung durch den „pawlowschen Hund“. Iwan Pawlow (russischer Physiologie, um 1900) stellte während seiner Forschungsarbeiten fest, dass seine Hunde schon beim Anblick des Futters und beim erscheinen der Pfleger mit speicheln reagierten und nicht erst bei Aufnahme der Nahrung.
Pawlow ging der Ursache nach und ließ im Rahmen seiner Versuchsreihe vor jedem Füttern eine Glocke erklingen. Schon bald speichelten die Hunde bereits wenn es klingelte, waren sie doch in Erwartung, gleich Futter zu bekommen.
Was ist passiert?
Das Klingeln der Glocke ist zu Anfang ein neutraler Reiz. Es bedeutet für den Hund nichts, dementsprechend reagiert er auch nicht darauf.
Speicheln wenn der Hund Futter sieht, ist angeboren. Eine unbedingte Reaktion (speicheln) auf einen unbedingten Reiz (Futter).
Jetzt wollen wir, dass der neutrale Reiz zu einem bedingten Reiz wird – und so auch eine bedingte Reaktion (speicheln beim klingeln) auslöst.
Neutraler Reiz (klingeln) + unbedingter Reiz (erscheinen des Futters) → unbedingte Reaktion (speicheln wg. Futter)
Der Hund wird nach einigen Durchgängen schon bei der Glocke anfangen zu speicheln. Jetzt ist die Glocke nämlich kein neutraler Reiz mehr, sondern hat für den Hund an Bedeutung gewonnen. Sie ist ein bedingter Reiz und sagt dem Hund, dass jeden Augenblick das Futter bereitsteht. Dass der Hund speichelt, wenn er die Glocke hört, ist dann eine bedingte (weil erlernte) Reaktion.
Das Ganze geschieht unbewusst, der Hund kann es nicht steuern!
Beispiel im Alltag:
Ein Mann mit Schirm geht im unmittelbarem Umfeld des Hundes über die Straße, im gleichen Moment hupt ein LKW so laut, dass der Hund sich stark erschreckt.
Wenn der Hund jetzt das nächste mal einen Mann mit Schirm sieht, könnte er die schlechte Erfahrung (lautes Hupen – Angst) auch mit dem Schirm verbinden und schon allein auf den Schirm ängstlich reagieren.
Der Schirm (neutraler Reiz) war dem Hund vor dem hupenden LKW (unbedingter Reiz) absolut egal, nun aber verbindet er etwas Negatives damit und reagiert entsprechend darauf (bedingte Reaktion).
Gleiches Prinzip natürlich auch bei der Arbeit über Strafe/Meideverhalten: die Chance, hier Fehlverknüpfungen – und neue Probleme - zu schaffen ist groß!
Operante/Instrumentelle Konditionierung
Bei der „operanten Konditionierung“ geht man davon aus, dass ein Lebewesen aktiv mit seiner Umgebung agiert. Während die klassische Konditionierung von bekannten Verhaltensweisen abhängig ist, kann man mit operanter Konditionierung neue Verhaltensweisen und Verhaltensketten trainieren.
Der Hund tut etwas und die Umwelt „reagiert“ entsprechend darauf, positiv oder auch negativ. Von dieser Reaktion hängt ab, ob das Verhalten in Zukunft häufiger oder weniger häufig gezeigt wird.
Das Prinzip ist also einfach – Lernen am Erfolg.
Beispiel:
Ich habe eine relativ nervöse Hündin. Bevor wir zum Spaziergang aufbrachen, rannte sie im Flur herum, streifte mich, schleppte Dinge an... zwischendurch stand sie aber auch für wenige Sekunden an der Tür und wartete.
Genau DAS habe ich verstärkt. Bevor der Hund nicht ruhig steht, geht es nicht raus, gibt es kein Leckerlie, gibt es wohl möglich sogar noch mürrisches Geknurre seitens des Zweibeiners.
Zur Zeit sieht es so aus, dass sie noch einmal durch den Flur streift und sich dann hinstellt und wartet. Warum? Weil sie gelernt hat, dass sich das Verhalten lohnt.
Was ist passiert?
Eine zufällige Aktion von dem Hund wurde verstärkt. Das Verhalten führte zu einer positiven Konsequenz für den Hund und lohnt sich damit. Verhalten welches sich lohnt, wird wahrscheinlich öfter gezeigt.
Wann lohnt sich Verhalten?
Vier Arten von Verstärkung bestimmen, wann sich Verhalten lohnt:
positive Verstärkung: hinzufügen von angenehmen Dingen – bedeutet, dass das Verhalten in Zukunft wahrscheinlich öfter gezeigt wird, weil es ANGENEHME Konsequenzen hat (Futter, Spiel, Streicheleinheiten, …)
negative Verstärkung: entfernen von unangenehmen Dingen – bedeutet, dass das Verhalten in Zukunft wahrscheinlich öfter gezeigt wird, weil es eine ANGENEHME Konsequenz hat (z.B. ein ängstlich-pöbelnder Hund lernt, dass die „Gefahr“ von ihm fern bleibt, wenn er nur genug Terz macht – es lohnt sich für ihn rumzupöbeln, er wird das Verhalten öfter zeigen, festigen.)
positive Bestrafung: hinzufügen von unangenehmen Dingen – das Verhalten wird in Zukunft wahrscheinlich seltener gezeigt, weil es UNANGENEHME Konsequenzen hat (Schmerz, Lärm...)
negative Bestrafung: entfernen von angenehmen Dingen – das Verhalten wird in Zukunft wahrscheinlich seltener gezeigt, weil es eine UNANGEHME Konsequenz hat (wegnahme von Futter, anleinen, …)
Um das Prinzip der „Verstärker“ bestmöglich auszunutzen, lohnt es sich vielleicht eine „Belohnungshitlist“ anzufertigen. ALLES was für den Hund als positiv empfunden wird, kann als Belohnung aufgeführt werden. Eine Belohnung ist ausserdem situationsabhängig! Ich kann einen verschmusten Hund haben, der sich normalerweise über Streicheleinheiten freut – hat er aber gerade einen anstrengenden Lauf hinter sich und Durst, wird er Wasser vermutlich als lohnender empfinden, als meine Streicheleinheiten.
Bei meiner Hündin sehe das im Alltag in etwas so aus:
- bewegliche, „lebende“ Spielzeuge, Beutespiele
- Spielzeug fordern (sie liebt es, mich anzukeifen
- Fressen
- …
Bei dem Yorkiteilchen so:
- läufigen Hündinnen nachschnüffeln
- Reizangel jagen
- …
Man sieht an den beiden schon sehr gut, wie unterschiedlich die „Belohnungshitlist“ sein kann.
Man unterscheidet ausserdem noch zwischen primären, sekundären und tertiären Verstärkern.
Primäre Verstärker befriedigen biologischen Bedürfnisse – z.B Hunger, Durst, Sozialer Kontakt
Sekundäre Verstärker werden erworben und es wird erlernt (klassische Konditionierung!), dass sie „gut“ sind. Sekundäre Verstärker kündigen den primären Verstärker an und haben so auch eine belohnende Wirkung. (Clicker!)
Der tertiäre Verstärker kündigt wiederum den sekundären Verstärker an. (intermediäre Brücke)
Später mehr dazu - ich bitte um Ergänzungen und Verbesserungen.